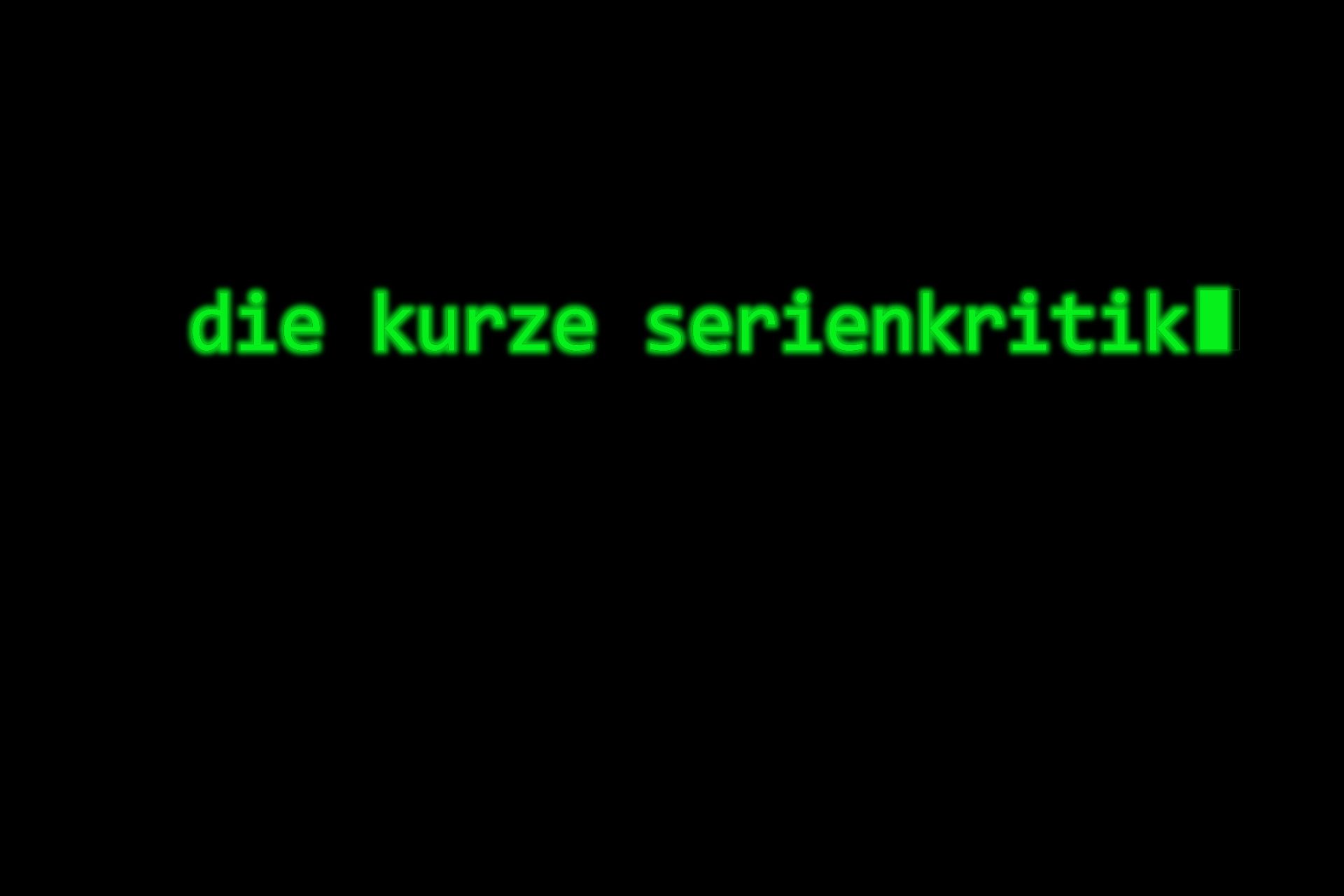Man stelle sich vor: Jack Ryan geht in Serie – und steht gar nicht im Mittelpunkt. Ok, das ist vielleicht etwas überspitzt formuliert. Doch den Ton gibt bei der Agentengeschichte jemand anderes an…
Was macht einen guten Bösewicht aus? Ganz einfach: Er ist nicht nur böse. Ein guter Bösewicht zeichnet sich vielmehr durch einen differenzierten Charakter mit einem tiefgehenden Background aus. Er folgt einer nachvollziehbaren Motivation und schafft somit beinahe schon Verständnis für das, was er tut. So zu beobachten beim Terroristen Suleiman in Tom Clancy’s Jack Ryan (englischer Titel, deshalb mit Apostroph). Und die Gegenfrage: Was macht einen guten Protagonisten aus? Nun, was Jack Ryan angeht, so ist er einfach nur… gut. Er besitzt einen durchtrainierten Oberkörper mit breiten Schultern. Er hat einen Doktor-Grad und ist entsprechend schlau. Und er verfügt über einen unbeirrbaren moralischen Kompass. So weit, so gähn.
Tom Clancy’s Jack Ryan trägt insofern den falschen Titel. Passender wäre gewesen: Tom Clancy’s Mousa Bin Suleiman. Denn über weite Strecken findet die Serie mehr Gefallen daran, Ryans Gegenspieler und dessen Wandlung vom diskriminierten Finanzfachmann arabischer Herkunft zum skrupellosen Extremisten in den Mittelpunkt zu stellen. Das Story-Konstrukt rund um den guten Bösen mutet zwar ein bisschen generisch an, hat aber als Aussage: Terroristen werden nicht als Terroristen geboren, sondern zu solchen gemacht. Was ihre Handlungen natürlich nicht rechtfertigt: Die notwendige kritische Sicht nimmt Suleimans Ehefrau Hanin ein. Die erkennt das Böse in ihrem Mann, flieht mit ihren Kindern und erlebt dabei eine ziemlich spannende Odyssee.
Der Post-9/11-Ryan
Was nun den anderen Typen angeht, also den Titelhelden – der muss wohl so sein, wie er ist. Der Jack Ryan in der Serie ist ein Post-9/11-Jack Ryan. Nicht umsonst erinnert er seine Vorgesetzten wiederholt daran, unbedingt einen neuen 11. September verhindern zu wollen, und rechtfertigt so seine eigenwilligen Handlungen. Das Resultat ist ein etwas zu eindimensionaler Held: Waren Harrison Ford und Alec Baldwin in den ersten Tom Clancy-Verfilmungen als CIA-Analysten – trotz Vergangenheit als US-Marine – noch Schreibtischtäter und Antihelden, kommt John Krasinski in der Rolle deutlich abgeklärter und tatendurstiger rüber.
Besonders deutlich wird das im Vergleich der sogenannten „Kontrollraumszenen“ in Film und Serie. Im Film Stunde der Patrioten zum Beispiel verfolgt Jack Ryan den Einsatz einer Spezialeinheit, die ein Terroristencamp in der Wüste ausschaltet. Harrison Ford spielt die Sequenz mit sichtbarem körperlichen Unbehagen und folgt der kaltblütigen Tötungsaktion auf dem Bildschirm richtiggehend angewidert. Ein kleiner und dezenter Verweis auf den Zynismus der Geheimdienste. Beim Serien-Jack Ryan gibt es solche Sequenzen auch. Dort folgt Krasinski dem Geschehen viel entschlossener – und erinnert dabei entfernt an Barack Obama auf dem berühmten Situation Room-Foto bei der Tötung Osama Bin Ladens.
Das Spiel mit dem Realismus
Sowieso spielt die Serie in ihrer ersten Staffel, die übrigens nicht auf einem Clancy-Buch basiert, sehr gekonnt mit realen Verweisen. Da wären natürlich das amerikanische Trauma von 9/11, aber auch Giftgasangriffe wie bei der japanischen Aum-Sekte Mitte der 90er, Ebola-Epidemien wie im vergangenen Jahr in Afrika oder das anhaltende Flüchtlingsdrama (in diesem Fall in der Türkei). Es gibt sogar eine kleine Nebenhandlung rund um einen Drohnen-Piloten, der die falsche Zielperson per Knopfdruck tötet und das mit seinem Gewissen vereinbaren muss. Ohne die Serie überhöhen zu wollen: Die Verwendung solcher Bilder soll natürlich gleichermaßen schockieren wie fesseln, zugleich verleiht sie der Story aber auch etwas Zwingendes.
Man merkt, dass mit Carlton Cuse (Brisco County, Lost, The Strain) und Graham Roland (Lost, Prison Break) zwei TV-Veteranen am Werk sind, die ganz genau kalkuliert haben, was sie tun. Tom Clancy´s Jack Ryan ist temporeich und aufwendig produziert. Die Serie spielt gekonnt mit verschiedenen Erzählebenen und Genre-Bausteinen. Und immer, wenn es zu viel Story und Charaktermomente gibt, wird eine Actionszene eingestreut, die auch nicht vor blutigen Gewaltspitzen zurückschreckt. Das alles macht Lust auf eine zweite Staffel – in der die Titelfigur dann auch gerne selbst etwas mehr Tiefe erhalten darf.
In Kürze: Erfreulich differenzierte, wenn auch etwas generische Agenten-gegen-Terroristen-Geschichte, versiert erzählt und aufwendig inszeniert. Die Stärken liegen ganz klar in der Zeichnung von Bösewicht und Nebenfiguren, beim Titelhelden ist noch Luft nach oben.
Bewertung: 8 / 10