Bohemian Rhapsody ist als Song ein Klassiker. Als Film allerdings ist es ein ambivalentes Vergnügen – je nachdem ob man ein Biopic erwartet oder ein Denkmal der Band Queen und ihres Sängers Freddie Mercury.
Ach, so einfach geht das… Da gründet man eine Band, und schon flutscht es. Erste Konzerte, erstes Album, Vertrag, Hit, noch mehr Konzerte, raus aus der britischen Provinz, ab in die Vereinigten Staaten. Der Erfolg fällt quasi vom Himmel, ganz ohne Vision, ohne Zweifel, ohne kreative Initialzündung. Und nach 25 Minuten steht man bei Top auf the Pops auf der Bühne. Moment, 25 Minuten? Ja, genau, so lange benötigt Bohemian Rhapsody, um die Gründung und den Aufstieg von Queen – insbesondere von Freddie Mercury – abzuhandeln. „Ich fürchte mich vor nichts“, sagt Freddie da an früher Stelle und zeigt sich als musikalisches Genie, das anscheinend nur fürs Publikum da ist. Der Anfang mit den ersten vier Band-Jahren im Schnelldurchlauf macht klar: Bohemian Rhapsody will natürlich auch ein Biopic sein. Vor allem ist er aber eines: ein Rock-Märchen.
Setzen wir aber zunächst die Biopic-Brille auf: Bohemian Rhapsody ist mit Blick auf die Band-Historie von Queen und vor allem das Leben von Freddie Mercury nicht immer ganz korrekt – und vor allem auch nicht vollständig. Der Film konzentriert sich auf die ersten 15 Queen-Jahre von der Gründung im Jahr 1970 bis zum Live Aid-Auftritt im Wembley-Stadion 1985. Und dabei beugt sich die Realität mehr als einmal der üblichen Filmdramaturgie. Nach 50 Minuten hat sich die Band mit dem Song Bohemian Rhapsody gegen den Willen des Plattenlabel-Chefs Ray Foster – tatsächlich hieß der Mann Roy Featherstone – durchgesetzt und macht sich endgültig daran, den Rock-Olymp zu erklimmen. Und nach einer knappen Stunde und damit etwa der Hälfte der Spielzeit folgt auf den Aufstieg der dramaturgisch vorprogrammierte Fall.
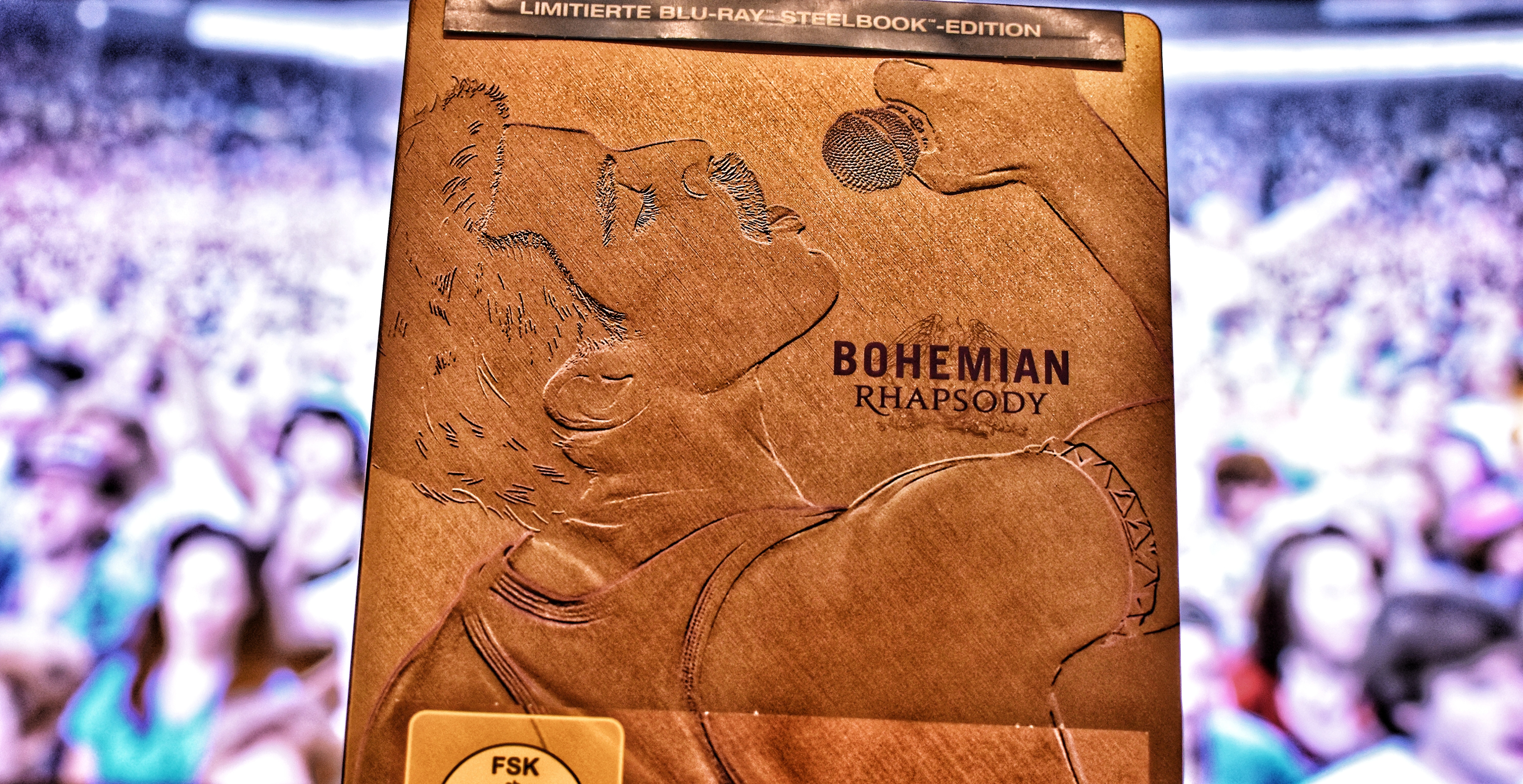
Wenn die Dunkelheit gekrochen kommt
Obwohl… So richtig fällt da niemand. Freddies Homosexualität wird zunächst nur mal kurz angedeutet, die Trennung von seiner Frau gut getimt auf der Länge des Songs „Love of my Life“ vollzogen. Freddie feiert eine extravagante Party und vertraut sich seiner späteren großen Liebe an: „Du denkst, du hättest die Dunkelheit hinter dir gelassen, und dann kommt sie wieder zurückgekrochen“, sagt er da. Mehr erfährt man als Zuschauer allerdings nicht über das Innenleben der Hauptfigur dieses Films. Nach anderthalb Stunden gibt’s die Trennung von der Band, Freddie geht nach München, feiert dort noch eine Party, auf der man kurz zwei Männer beim Knutschen sieht, und zehn Minuten später kehrt er reumütig zurück. Freddie gesteht seine AIDS-Erkrankung, dann geht’s zum Finale nach Wembley.
Mit anderen Worten: Bohemian Rhapsody ist eine gut durchkomponierte Show in einem straffen Korsett. Nur ein Biopic über Freddie Mercury, über das, was vielleicht oder vielleicht auch nicht in ihm vorgegangen ist, darüber verrät der Film nichts. Auch nicht darüber, was er so getrieben hat. Und erst recht nichts darüber, was die restlichen Bandmitglieder getrieben haben. Um mal einen Vergleich zu bemühen: Hätte Bohemian Rhapsody das Partyleben von Queen adäquat auf die Leinwand bringen wollen, dann hätten sich dagegen die Ausschweifungen und die Dekadenz von Martin Scorseses Wolf of Wall Street ausgenommen wie der reinste Kindergeburtstag. Eine Freigabe ab 6 Jahren wäre jedenfalls nicht mehr drin gewesen.
So sinniert Freddie in einigen Szenen also nur mit Sektglas in der Hand und aus dem Fenster stierend. Brian May ist einfach da und lächelt stets nett. Und Roger Taylor sowie John Deacon sind irgendwie auch da, allerdings in besseren Statistenrollen. Selbst die kurze Episode, wie Deacon bei Queen an den Bass gekommen ist, wird komplett ausgespart, er steht nur plötzlich mit auf der Bühne.

Kann es nicht einfach mal schön sein?
Es hilft also alles nicht, wir müssen die Feel-Good-Brille aufsetzen. Und siehe da: Der Film funktioniert als Gute-Laune-Sause doch gleich viel besser. Soll heißen: Es gibt keine große innere Handlung, keine inneren Dämonen, die langwierig die Handlung aufhalten und die Stimmung versauen. Alles passiert ganz einfach, und zwischendurch gibt es viele Klassiker von Queen zum Mitfeiern. Das ist vielleicht nicht sonderlich innovativ inszeniert, aber doch mehr als solide. Und es macht eben – auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole – Laune! Muss man da wirklich die ganzen unschönen Details erfahren, die sich anscheinend in Freddies Münchner Zeit ergeben haben? Die ganzen Exzesse? Die Drogen? Barbara Valentin? Im Grunde eigentlich nicht, wenn man denn „nur“ Spaß haben will. Man kann der „Legende Queen“ auf der großen Leinwand folgen und die alten Zeiten, in denen man zu ihren Songs abgefeiert hat, wieder aufleben zu lassen. Ohne störende Zwischentöne. Aber mit „We will rock you“ auf Anschlag.
Tja, jeder Zuschauer sollte wohl selbst entscheiden, was ihm lieber ist. Der Film bietet der einen Seite etwas und der anderen Seite etwas mehr. Bleibt noch das obligatorische Lob: Freddie-Darsteller Rami Malek bekommt vielleicht nicht so viel Gelegenheit, das Innenleben seiner Figur zu zeigen. Aber er ist ein guter Freddie-Imitator, wenn auch mit deutlich zu großem Überbiss. Gwilym Lee hat sich genauso großes Lob als Brian May verdient. Und Ben Hardy als Roger Taylor sowie Joseph „Jurassic Park“ Mazello als John Deacon sehen ihren echten Vorbildern zum Verwechseln ähnlich. Die echten May und Taylor waren über die Jahre sehr erfolgreich, die Legende Queen am Leben zu erhalten, mal als Musical, mal mit Paul Rodgers, mal mit Adam Lambert. Und mit Bohemian Rhapsody dürften sie der Band endgültig ein Denkmal gesetzt haben. Ohne größere Risse.
In Kürze: Aufstieg und Drama-Phase der Band Queen und ihres Sängers Freddie Mercury im straff getimten Story-Korsett. Als Biopic aufgrund von Ungenauigkeiten und Oberflächlichkeiten nur bedingt zu gebrauchen. Als harmloses Rock-Märchen mit einem zeitlosen und gutelaunigen Soundtrack aber sehr gelungen.
Bewertung: 6 / 10 (Biopic-Wertung), 8 / 10 (Rock-Märchen-Wertung)


2 comments